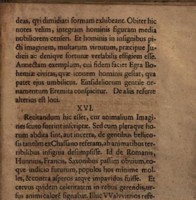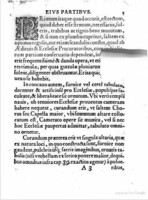Nachträgliche Vorbemerkung (07. September 2019)
Nicht alles wird schlechter. Seit der Erstfassung dieses Essays wurde seitens der Bibliotheken und des Konzerns offenbar viel nachgearbeitet. Zahlreiche (bei weitem nicht alle) Digitalisate wurden bereinigt und stehen nun in besserer Qualität, d.h. lesbar zur Verfügung. Ich habe gleichwohl davon abgesehen, für alle Fälle, die unterdessen korrigiert wurden, neue Beispiele anzugeben. Etliche links mit Fotos von misslungenen Scans führen daher inzwischen zu brauchbaren Digitalisaten. Der Beitrag sollte somit auch als Zeugnis eines Entwicklungsstandes der Retrodigitalisierung verstanden werden.
Als im Jahr 2010 in Deutschland mehrere hunderttausend Mieter und Hausbesitzer von ihrem Recht Gebrauch machten und die Außenaufnahmen ihrer Gebäude im Internet-Panoramadienst Google Street View durch Verpixelung unkenntlich machen ließen, erhob sich umgehend öffentliche Empörung, die bisweilen in offenen Protest mündete. So sahen einige Internetaktivisten darin einen Angriff auf die Informationsfreiheit und formulierten unter Berufung auf die im „Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“ verbürgte „Panoramafreiheit“ Widerspruch gegen die zugrundeliegende Rechtsprechung.1 Widerstand äußerte sich neben verbalen Ausfällen und vereinzelten Eierwürfen auf Fassaden auch in Form von klandestinen Fotoshootings: Die von Privatpersonen erstellten Aufnahmen der betroffenen Häuser wurden nachträglich als User-Generated-Content und damit als von der rechtlichen Verpflichtung zur Unkenntlichmachung nicht berührte Bilder in Street View bzw. Google Maps eingebunden.2
Der erstaunliche Umstand, dass eine – hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit – signifikante Anzahl von Personen im Produkt eines gewinnorientierten Weltkonzerns die Verwirklichung eigener ideologischer Ziele erkannte und aus diesem Grund ihre privaten Produktionsmittel zur Kompensation rechtlich bedingter Einschränkungen in dessen Dienst stellte, bedürfte einer eigenen Untersuchung. Festzuhalten ist in jedem Fall die hohe, gleichwohl diffuse Erwartung an den Nutzen des Produkts als Medium der Demokratisierung von Information.
Sehr viel konkretere Kritik wurde fast zeitgleich von Immobilienagenturen und Maklern geäußert, die in ihre Internetauftritte den Kartendienst Google Maps integriert hatten und Street View somit als eine willkommene Ergänzung ihres Angebots auffassten. Diese kommerziellen Nutzer befürchteten, dass potenzielle Kunden sich bei einer intensivierten Unkenntlichmachung kein genaues Bild vom jeweiligen Quartier und der unmittelbaren Umgebung einer (selbst nicht verpixelten) Immobilie machen und daher bereits im Vorfeld in ihren Kaufabsichten irritiert werden könnten.3
Angesichts der hier erkennbaren zugrundeliegenden Verwertungslogik scheint es zumindest fraglich, ob die netzpolitischen Erwartungen an die Digitalisierung des öffentlichen Raums nicht ebenso dazu tendieren, enttäuscht zu werden wie die politischen Hoffnungen auf die „Literarisierung der Lebensverhältnisse“ im frühen 20. Jahrhundert.4 Die parallel erfolgte Kritik an der Rechtsprechung (und vor allem an der aktiven Inanspruchnahme des Rechts) im Fall von Google Street View von zwei so unterschiedlichen Interessengruppen ist geeignet, nach dem Wandel der ökonomischen Verhältnisse im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten zu fragen. Unmittelbar erkennbar wird dieser Wandel beim Versuch, das Angebot in Güterkategorien der klassischen ökonomischen Theorie zu fassen. Die Immaterialität der Daten und ihrer Visualisierung sowie ihre Abrufbarkeit könnten dazu verleiten, in Street View eine Dienstleistung zu erkennen. Tatsächlich aber handelt es sich um eine als Dienstleistung nur verlarvte Ware, was daran deutlich wird, dass seitens des Anbieters kein individueller Zuschnitt des Angebots auf das Bedürfnis des Nutzers resp. Kunden erfolgt, sondern dieser sich mit Hilfe von Filtern einen Ausschnitt aus dem feststehenden und nur noch in Einzelfällen aktualisierten oder korrigierten Produkt (vergleichbar mit einem gedruckten Stadtplan oder einem Satellitenfoto) anzeigen lässt.5
Die Nutzungsmöglichkeiten des Panoramadienstes sind jedoch, wie die Heterogenität der an ihn geknüpften Erwartungen und Ziele zeigt, vielfältig. Selbst wenn man sie auf das Funktionsspektrum ‚Orientierung‘ reduziert, unterscheiden sich die konkreten Anwendungsweisen und die zugrundeliegenden Motivationen erheblich. Karl Marx hat in seiner Definition der Ware bemerkt, dass Dinge „nach verschiedenen Seiten nützlich“ sein könnten und es „geschichtliche Tat“ sei, „die mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken“.6 Der Gebrauchswert eines Dings und damit sein Warencharakter wiederum werden bestimmt durch die jeweils festgestellte oder unterstellte Nützlichkeit in Bezug auf bestehende Bedürfnisse. Anders gesagt, die Bestimmung des Gebrauchswertes ist weitgehend den Nutzern überlassen, ohne dass seitens des Anbieters bestimmte Nutzungsweisen besonders hervorgehoben oder ausgeschlossen würden. Angesichts der nicht klar definierten Nützlichkeit von Street View erweist sich das digitale Double der Straße als Ding, das sein Warenpotenzial in unterschiedlichen Verwertungszusammenhängen jeweils anders realisiert. Nützlichkeit gepaart mit kostenloser Verfügbarkeit sind klassische Eigenschaften eines Werbeartikels und dienen der Markenetablierung und Kundenbindung. In dieser Perspektive war Street View vor allem eine Investition in die allgemeine Bekanntheit und die Etablierung von Google Maps als einem der wichtigsten und profitabelsten Medien für die Schaltung von lokaler Werbung.
Dass demnach Nutzbarkeit und Nützlichkeit des Abbilds ganz anders ausfallen als beim Gegenstand selbst, ist im Fall von Häusern und Straßenansichten eine triviale Feststellung; gleichwohl erweist es sich in kritischer Absicht als hilfreich, diese Utlilitätsdivergenz auch dort im Blick zu behalten, wo sie weniger offensichtlich ist, wo das Abbild scheinbar dasselbe Verwertungspotenzial besitzt wie sein Gegenstand – im Fall des digitalisierten Buches.
Die vielfältigen Vorzüge der Retrodigitalisierung des alten Buches für die geisteswissenschaftliche Forschung müssen an dieser Stelle nicht ausbuchstabiert werden. Für die historiographische Arbeitspraxis stellt die inzwischen unüberschaubare Menge an digitalisierten und im Internet verfügbaren Werken einen kaum zu überschätzenden Fortschritt in der Auffindung und Erschließung gedruckter Quellen dar.7 Erheblich erleichtert ist insbesondere die Arbeit mit seltenen Druckschriften des 15. bis 18. Jahrhundert – und ähnliches gilt auch für die fortschreitende Digitalisierung von Handschriften, Bildern und Objekten. In vielen Fällen sind zeit- und kostenaufwändige Reisen zur Einsichtnahme verstreuter Exemplare in verschiedenen Bibliotheken nicht mehr nötig, wenn das entsprechende Buch online zur Verfügung steht. Noch viel häufiger aber erlaubt der mittlerweile vorliegende Bestand an Digitalisaten im Internet die spontane und umgehende Konsultation bestimmter Werke gänzlich unabhängig von Öffnungs- und Bereitstellungszeiten. Es bedarf nicht viel Phantasie, die Digitalisierung des literarischen Altbestandes als eines der zeittypischen Beschleunigungssymptome zu begreifen, von denen auch die wissenschaftliche Forschung erkennbar geprägt wird.
Indes sollen hier nicht einmal mehr die bekannten Argumente aus der erstaunlich schnell obsolet gewordenen Grundsatzdebatte um Wohl und Wehe der Digitalsierung wiederholt werden.8 Vielmehr widmet sich der vorliegende Essay den eigenartigen ökonomischen und kulturellen Transformationen, die das alte Buch durch seine Digitalisierung erfährt, und versteht sich mithin als unvorgreiflicher Beitrag zur Analyse der gegenwärtigen Buchkultur. Es geht dabei um Warenproduktion mit Hilfe öffentlichen Eigentums, um Wissenschaftsmarketing, um Nützlichkeit und Ästhetik des minderwertigen Digitalisats – und letztlich vielleicht auch um die Frage, warum empörte Netzbürger Eier auf Wohnhäuser aber nicht auf Bibliotheken werfen.
Digitalisierung als Warenproduktion
Das Buch mag Medium oder Residuum des Geistes sein (es gibt genügend Beispiele, die daran zweifeln lassen), ganz sicher ist es Element oder gar Akteur symbolischer und kultureller Ökonomien – vor allem aber ist es eine Ware. Selbst wer dem romantischen Bild von solitärer, autonomer und inspirierter Autorschaft nachhängt, wird eingestehen müssen, dass das Buch zumindest in seiner materiellen Erscheinung schon seit einigen Jahrhunderten das Ergebnis eines arbeitsteiligen, maschinengestützten und im Grunde industriellen Produktionsprozesses ist, der untrennbar mit den sich wandelnden Möglichkeiten, Erfordernissen und Risiken des Buchmarktes verkoppelt ist.
Michael Giesecke hat darauf hingewiesen, dass der Marktpreis eines Buches unabhängig vom intellektuellen Aufwand seiner Abfassung sowie von den Kosten, die der Erwerb der für den Text notwendigen Erfahrung (paradigmatisch: Reiseberichte) verursacht hat, zustande kommt.9 Das ist, vielleicht zu Recht, eine sehr intellektualistische Perspektive, in der sich für die Arbeitskraft des Geistes im Gegensatz zu der des Körpers kein angemessenes Monetarisierungsäquivalent finden lässt. Dergleichen gilt indes für jegliche Ware, insofern deren Preis eben nicht primär vom Produktionsaufwand (welcher Art dieser auch immer sei), sondern vom Gebrauchswert bzw. vom Gebrauchswertversprechen bestimmt wird. Gut erkennbar ist dies im antiquarischen Buchmarkt, dessen Konjunkturen gänzlich losgelöst von den einstmaligen Interessen der Autoren und Verleger der gehandelten Bücher verlaufen. Kurz gesagt: Geist spielt für den Preis nur insofern eine Rolle, als er ein Versprechen der Nützlichkeit darstellt – was bekanntlich nicht das einzige Motiv für den Erwerb von Büchern ist. Diese Koppelung von Gebrauchswertversprechen und Preis löst sich in der Regel in dem Moment, in dem das Buch seinen Warencharakter verliert.
Der Historiker Krzysztof Pomian hat auf die eigentümliche Transformation des symbolischen und materiellen Wertes von Gegenständen hingewiesen, die sich mit ihrem Übertritt aus den Bezirken der Warenzirkulation in eine Sammlung vollziehen. Eine Sammlung ist nach Pomian „jede Zusammenstellung natürlicher oder künstlicher Gegenstände, die zeitweise oder endgültig aus dem Kreislauf ökonomischer Aktivitäten herausgehalten werden, und zwar an einem abgeschlossenen, eigens zu diesem Zweck eingerichteten Ort, an dem die Gegenstände ausgestellt werden und angesehen werden können“.10 Das Ausscheiden aus den Marktzusammenhängen bedingt im Fall der Sammlungsgegenstände bzw. Exponate unmittelbar einen radikalen Verlust des Gebrauchswertes: Die ausgestellten Gegenstände sind, hinsichtlich ihrer ursprünglichen Funktion, nutzlos geworden, insofern sie diese Funktion aus konservatorischen Gründen nicht mehr ausüben.
Lokomotiven und Eisenbahnwagen, die in einem Eisenbahnmuseum stehen, transportieren keine Reisenden und Güter mehr. Die in einem Armeemuseum deponierten Schwerter, Kanonen und Gewehre dienen nicht mehr zum Töten. Utensilien, Werkzeuge und Kostüme, die Teile eines ethnographischen Museums oder einer Sammlung sind, haben keinen Anteil mehr an Alltag und Arbeit der Bevölkerung in Stadt und Land. Und so verhält es sich mit jedem einzelnen Ding, das in dieser fremden Welt gestrandet ist, aus der alle Nützlichkeit auf immer verbannt zu sein scheint.11
Dem Verlust des Gebrauchswertes steht eine immense Erhöhung des Tauschwertes dieser Objekte gegenüber. Nach Pomian beruht diese Aufwertung auf der Umdeutung der Objekte zu Repräsentanten des „Unsichtbaren“, d.h. zu Trägern zugeschriebener Bedeutung, die über ihren einstmaligen Funktionszusammenhang hinausgeht. Für diese Bedeutungs- und mithin Wertzuschreibung aber ist die Herauslösung aus ökonomischen Kreisläufen eine conditio sine qua non.12
Pominan deutet zwar an, dass sein Modell ebenfalls für Bibliotheken gelte, bleibt nähere Ausführungen allerdings schuldig.13 Tatsächlich gibt es – vorwiegend im Bereich des alten Buchs, um das es hier gehen soll (mit einem Druckdatum vor 1850) – Exemplare, deren Objektstatus dem des Museumsexponats gleicht. Bibliotheken und mitunter auch Museen besitzen Exemplare aus der Zeit der Handschriften und des gedruckten Buches, deren Seltenheit oder Einzigartigkeit verbunden mit einer durch Ausstellungen und Publikationen konstituierten und aktualisierten Bedeutung ihnen das Ansehen und die Funktion eines reliquiengleichen Gegenstandes verschafft. Nicht selten stehen dabei die materielle und symbolische Dimension des Buches im Vordergrund, wenn etwa die inhaltliche Bedeutung hinter der historischen weit zurückfällt (im Fall der Gutenberg-Bibeln) oder wenn einzelnen Büchern aufgrund ihrer besonderen Ausstattung – Einbände, Illuminationen, Illustrationen – Denkmalcharakter zukommt. In dieser Hinsicht lassen sich individuelle Nutzungsspuren (Erasmus' Ausgabe seiner Laus Stultitiae mit den Zeichnungen von Holbein oder das sogenannte Bordeaux-Exemplar Montaignes) als Folgen eines nachträglichen oder sekundären Produktionsprozesses begreifen, der sich von dem primären dahingehend unterscheidet, dass er ein Unikat schafft, dessen von bibliophilen oder historiographischen Interessen bestimmter Mehrwert gerade auf der Abweichung von allen anderen Exemplaren beruht.
Mit Ausnahme besonders schützenswerter oder aus juristischen Gründen unzugänglicher Werke besitzen Bücher in öffentlichen Bibliotheken indes anders als Pomians Kunstkammerobjekte und Museumsexponate einen erkennbaren Nutzen und mithin einen Gebrauchswert, der ihre mitunter kostspielige und von öffentlichen Geldern finanzierte Aufbewahrung, Erhaltung und Bereitstellung überhaupt erst rechtfertigt. Gleichwohl lässt sich trotz der an Ausleihzahlen ablesbaren Nachfrage keine unmittelbare Korrespondenz zum Tauschwert feststellen, insofern dieser außerhalb von Bibliotheken erzeugt und von anderen Faktoren als dem in Bibliotheken üblichen Gebrauch bestimmt wird. Da die Bestände in der Regel unveräußerlich sind, spielt für öffentliche Bibliotheken der Tauschwert eines Buches nur insofern eine Rolle als er die Institutionen zur Einrichtung von Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des öffentlichen Eigentums nötigt.
In diesem Sinne waren Diebstahl, Doublettenverkauf und Faksimileeditionen lange Zeit die einzigen Verfahren der Remerkantilisierung, der Wiedereinspeisung des alten Buchs in den Warenkreislauf.14 Mit der Digitalisierung, die in den frühen 1990er Jahren begann,15 hat sich unterdessen eine Praxis etabliert, die – am ehesten vergleichbar mit dem Faksimiledruck – von Exemplaren, die als öffentliches Eigentum in Bibliotheken dem Markt im Grunde endgültig entzogen sind, Doubles herstellen, die erneut dem Warenkreislauf zugeführt werden können. Ohne Unterscheidung in Hinblick auf ursprüngliche Auflagenhöhe oder die Anzahl heute erhaltener Exemplare werden Rara und Rarissima, Inkunabeln sowie die durch Gebrauch und Eingriffe in das Material unikalisierte Druckwerke durch die Digitalisierung zur Massen-Ware. Das einzelne Exemplar erhält durch seine Verfügbarkeit über das Internet prinzipiell unendlich viele Doubles, wird damit also zum potenziell massenhaft verbreiteten Objekt. Dabei ist es angesichts einer zumeist ohne Abstimmung zwischen den zahlreichen nationalen und internationalen Digitalisierungsprojekten, häufig allein aufgrund lokaler Bedürfnisse, Anforderungen und Bedingungen getroffenen Auswahl freilich bedenklich, dass ohne philologisch-bibliothekarisch begründeten Befund (etwa qua Kollationierung) ein bestimmtes Exemplar in der Benutzung unwillkürlich zum digitalen Archetypus eines Werkes gerät – mit bislang noch nicht ausreichend reflektierten Folgen für die Werkrezeption. Neben das „Verschwinden des Exemplars“ in seiner spezifischen Materialität,16 tritt die Ubiquisierung seines Abbilds.
Der Warencharakter des Digitalisats offenbart sich dort, wo der Zugang kostenpflichtig ist. Selbst wenn der Verkauf von Lizenzen allein zur Deckung der Produktionskosten dient, wie im Fall von nicht-profitorientierten Anbietern wie Early English Books Online (EEBO) oder Eighteenth Century Collections Online (ECCO), ist die Bereitstellung der Digitalisate an eine finanzielle Gegenleistung seitens der Käufer gekoppelt.17 Sichtbar wird die digitale Remerkantilisierung des alten Buchs aber vor allem, wenn Book-on-Demand-Verlage aus (gemeinfreien) Digitalisaten wieder (aus-)gedruckte Bücher machen und über den Buch- und Antiquariatshandel vertreiben.18 Eine derartige massenhafte Verwertung von Domanialeigentum zur Warenproduktion war bisher nur im Produktsegment von Kunstpostkarten und ähnlichen Reproduktions-Artikel bekannt.
Digitalisate sind nicht einfach nur fotografische Kopien von Büchern, sondern eine Ware sui generis – auf einem Markt, der sich zumindest in Hinblick auf das Retrodigitalisat derzeit noch in einer Phase der Strukturierung und Ausdifferenzierung befindet. Dass ein immerhin sehr großer Teil der im Internet verfügbaren Altbestands-Digitalisate kostenlos abgerufen werden kann, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass tatsächlich ein Wettbewerb stattfindet. Dies zeigt sich nicht nur an den politischen Schwierigkeiten bei der Organisation länderübergreifender Digitalisierungsprojekte,19 sondern auch daran, dass Geschwindigkeit bei der Schaffung von digitalen Beständen ein Faktor ist, der den der Qualität bzw. Nützlichkeit bisweilen an Relevanz übertrifft. Diese Entwicklung verdankt sich freilich der Logik des Wissenschaftsmarketings, von dem neben den Universitäten auch Forschungsinstitutionen und Bibliotheken erfasst sind. Die Bereitstellung kostenloser Ware ist aus Sicht der Institutionen nämlich primär keine Investition in Forschung und Bildung, sondern in die Generierung von öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Fördergeldern, insofern Nutzerzahlen zu einer entscheidenden Kategorie der Evaluierung und Bezuschussung öffentlicher Einrichtungen geworden sind.
Digitale Warenästhetik
Für die Kultur des frühneuzeitlichen Europa stellten Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks weniger eine technische oder gar intellektuelle Revolution dar, sondern in erster Linie eine ökonomische. Mit der mechanisch beschleunigten Produktion von Büchern etablierte sich binnen weniger Jahrzehnte ein Markt, dessen Umsatzvolumen sich erheblich vom Handel mit Handschriften unterschied und mit zunehmendem Angebot eine ernsthafte Konkurrenzsituation schuf, in der sich die Druckerzeugnisse behaupten mussten. Der Prozess der Verbreitung – oder wenn man so will: der Demokratisierung – des Buchs war mithin keine Folge gesteigerter Bibliophilie sondern der marktbedingten Verfügbarmachung.20 Allem medienpolitischen Enthusiasmus zum Trotz sind historiographisch fassbare Prozesse von Medienwandel und Medienwechsel vor allem Ausdruck der Entstehung und Erschließung neuer Märkte.
Als Handelsware besaß das gedruckte Buch (wie vor ihm natürlich auch schon die Handschriften) von Anfang an eine Warenästhetik, d.h. seine formale Gestaltung war und ist auf den bestmöglichen Absatz gerichtet. Am deutlichsten manifestiert sich dies in der Orientierung an gestalterischen Standards und Moden bereits etablierter, d.h. erfolgreich vermarkteter Buchformen. So ist der von der buchhistorischen Forschung bemerkte Umstand, dass der Buchdruck noch bis etwa 1530 das Erscheinungsbild von Manuskripten imitierte, bevor sich eigene ästhetische Konventionen herausbildeten,21 ebenso auf eine ökonomische Konkurrenzsituation zurückzuführen, wie die Mitte des 16. Jahrhunderts einsetzende Umkehrung der Verhältnisse: Nunmehr und bis sie als Kommunikationsmedien kulturell irrelevant geworden waren, orientierte sich die Gestaltung von Manuskripten an der Ästhetik des gedruckten Buches.22 Ähnliches ließe sich für Entstehung, Verbreitung und Entwicklung von Typographie, Seitengestaltung, Druckersignets, Paratexten, Autorenporträts und dergleichen zeigen. Entscheidend ist, dass sich mit der Mechanisierung der Buchproduktion, d.h. vor allem mit dem Letterndruck, eine Diskretisierung der äußeren Erscheinung des Buches vollzieht: Die individuelle Handschrift des oder der Schreiber, womöglich gar des Autors, wurde durch eine einheitliche, zum Teil verlagstypische, markenbildende Schriftgestaltung (etwa Aldus Manutius' Antiqua) ersetzt. Wie auch in anderen Wirtschaftszweigen führte auch im Verlagswesen die Mechanisierung der Produktion zu einer „Ausschaltung der Handarbeit“23 und zur einheitlichen Massenware, wobei das Fehlen menschlicher Bearbeitungsspuren zunehmend zu einem Qualitätsmerkmal wurde. Unikate sind seitens der Produzenten weder vorgesehen noch erwünscht sondern meist Folgen technischer Störungen und werden nach Möglichkeit ausgesondert bevor sie in Umlauf kommen. Ausnahmen, wie Laurence Sternes Life and Opinions of Tristram Shandy (1759-1767), in dessen Exemplaren ein je einzigartiges Trunkpapier (marmoriertes Papier) eingebunden wurde, sind als Reaktion auf die prinzipielle Uniformität des gedruckten Buches zu verstehen. Die – bisweilen sogar handschriftliche – Nummerierung kleiner (‚limitierter‘) Auflagen steht dazu nicht im Widerspruch: Diese betont lediglich die Seltenheit eines Exemplars, nicht dessen Einzigartigkeit.
War die Unsichtbarkeit der Hände, die an der Produktion des Buches beteiligt waren, Bedingung der Serialität und Standardisierung und diese wiederum Grundvoraussetzungen für die Ausbildung einer informationszentrierten, ja -fixierten Kultur, so ist das Auftauchen von Händen im digitalisierten Buch ein immerhin erstaunliches Phänomen, dessen Ursachen eine nähere Betrachtung verdienen. Bereits seit einigen Jahren steht die Qualität der von Google Books erstellten Retrodigitalisate in der Kritik. In diesem Zusammenhang wurde verschiedentlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass auf zahlreichen gescannten Buchseiten Hände zu finden sind (Galerie 1). Dies ist nicht die einzige Art der Störung, die die Benutzung eines Digitalisats unmöglich machen kann (Galerie 2), mit Sicherheit aber die bezeichnendste.24 Scherzhaft mag man dies als allzu wörtliche Umsetzung von ‚Digitalisierung‘ abtun: Der Finger – digitus – hat seinen Weg ins Bild gefunden. Es sind jedoch indexikalische Finger: Sie weisen auf etwas Ernsthaftes hin, nämlich die fragwürdigen Bedingungen und Ursachen ihrer Sichtbarwerdung.
Robert Darnton hat ausgehend von einem Daumenabdruck in einem Exemplar der Encyclopédie die Lebens- und Arbeitsumstände der an der Herstellung des Werkes beteiligten Drucker dargestellt. Die Spur der Hand ist Darnton zufolge das Resultat eines Tricks, mit der sich die Handwerker die körperlich anstrengende Arbeit des Druckens erleichterten: Indem der Setzrahmen mit den Lettern mit mehr Druckschwärze eingefärbt wurde als nötig, bedurfte es bei der Bedienung der Presse weniger Muskelkraft, um einen satten Abdruck zu erhalten. Bei diesem Verfahren konnte jedoch leicht Druckschwärze an die Hände der Beteiligten geraten, die dann auf den Bögen Flecken hinterließen. Der Daumenabdruck zeugt mithin vom Eigensinn der Arbeiter und deren Praktiken der Arbeitsentlastung.25
In dieser sozialhistorischen Perspektive könnte in ähnlicher Weise anhand der digitalisierten Hände der Versuch unternommen werden, die soziale Herkunft der Arbeiterinnen und Arbeiter an den Buchscannern zu bestimmen. Während in den USA schon die Hautfarbe diesbezügliche Hinweise liefern kann und die gescannten Hände deshalb bereits Eingang in die Debatte um eine ethnisch bedingte Ungleichbehandlung am Arbeitsmarkt fanden,26 müssten in Europa in erster Linie Uhren, Schmuck und der Zustand der Fingernägel als Indizien geschlechtlicher, alters- und klassenspezifischer Gesellschaftszugehörigkeit herangezogen werden. Indes besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Abdrücken von farbverschmierten Druckerhänden und den Abbildern der gummibezogenen Hände von Googles Angestellten. Die gescannten Hände sind nämlich nicht Folge eines eigenmächtigen, kräftesparenden Umgangs mit den Produktionsmitteln, sondern unbeabsichtigte Fehlleistungen, deren Häufigkeit darauf hindeutet, dass der Produktionsprozess selbst diese maßgeblich begünstigt. In der traditionellen, d.h. industriell geprägten Warenproduktion, wie sie von Marx beschrieben wurde, erfolgte die Koppelung von Maschine und Mensch unter der Bedingung eines möglichst störungsfreien Produktionsprozesses, um bei erhöhter Produktivität die Ausschussquote gering zu halten. Spätestens seit den Forschungen zur Psychotechnik und der Durchsetzung des ‚Fordismus‘ gehört es zu den ökonomischen Binsenweisheiten, dass dort, wo Produktionsabläufe auf das Mitwirken menschlicher „Teilmaschinen“27 nicht verzichten können, die physiologischen Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit an die Maschine und die von ihr diktierten Arbeitsabläufe berücksichtigt werden müssen. Wo dies nicht geschieht, ist es eine im Grunde notwendige Folge, dass das prinzipielle Zurückbleiben des Organischen hinter dem Automatischen sichtbar wird.28
Das in Hinblick auf die Qualität der Scans aus anderen Projekten zur Digitalisierung alter Bücher relativ hohe Maß an Fehlproduktion im Fall von Google Books ist daher als Folge einer Effizienzstrategie zu betrachten, die die bisweilen erhebliche Minderung des Gebrauchswerts der Digitalisate billigend in Kauf nimmt.29 Es ist dabei grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Fehlern und Qualitätseinbußen, welche durch die verwendete Technik sowie die Vorlagen (insbes. bei Mikroformen oder beschädigten Bänden) bedingt sind, und der bewussten Vernachlässigung von prinzipiell möglichen Verfahren der Qualitätssicherung.
Dass die Fehler und Mängel im Fall von Google Books verfahrensbedingt sind, lässt sich leicht daran erkennen, dass die Digitalisate verschiedener Exemplare eines Werkes – aus unterschiedlichen Bibliotheken – dieselben Negativmerkmale aufweisen. So zeigt sich etwa im Vergleich, dass die Weigerung, Falttafeln aufzuklappen (Galerie 3), keine Eigenwilligkeit einzelner Angestellter ist, sondern Methode hat (Abb. 1-4).
Abb. 1-4: Athanasius Kircher. Tariffa Kircheriana Id Est Inventum Aucthoris Novum. Rom: Tinassius, 1679, ad fol. 187. Exemplare der Biblioteca Complutense de Madrid (Signatur: BH DER 12232), Bibliothèque Municipale de Lyon (Signatur: 803568), Österreichischen Nationalbibliothek Wien (Signatur: *43.X.130.(Vol.1)), Biblioteca Nazionale di Napoli (Signatur: XXXV A 31).
Die augenscheinliche Geringschätzung des alten Buches im Allgemeinen und die offensichtliche Ignoranz gegenüber der herausragenden Bedeutung der Buchgraphik für die Kultur- und Wissensgeschichte im Besonderen sind immerhin bemerkenswert.30 Bemerkenswert vor allem, wenn es sich um große und für ihren Altbestand berühmte Bibliotheken wie die Bayerische Staatsbibliothek in München oder die Österreichische Nationalbibliothek in Wien handelt, die große Teile ihre Sammlungen für Googles Massendigitalisierungsprojekte zur Verfügung stellen und die mitunter unglücklichen Ergebnisse – unbesehen oder wohlweislich – auch auf ihre eigene Homepage stellen. Die im Onlinekatalog lesbare Behauptung, ein Buch könne „vollständig online“ gelesen werden, ist in solchen Fällen schlichtweg falsch und irreführend. Welchen Nutzen hat etwa ein Digitalisat von Albrecht Dürers Abhandlung über Fortifikationsarchitektur von 1527, wenn dessen Bildtafeln, die unentbehrliche Informationsträger des Buches sind, geschlossen sind und zudem noch Teile des Textes verdecken?31 In welcher Weise kann ein unleserliches Digitalisat der Bestandssicherung dienen, die regelmäßig als ein Argument für die Notwendigkeit der Massendigitalisierung genannt wird? Es liegen bislang keine offiziellen Zahlen über fehlerhafte und unvollständige Digitalisate vor, und man wird nicht erwarten dürfen, dass seitens Google und der kooperierenden Bibliotheken ein ernsthaftes Interesse besteht, diese zu erheben bzw. publik zu machen. Wer aber meint, angesichts mehrerer Millionen gescannter Bücher fielen die unbrauchbaren Digitalisate nicht ins Gewicht, verkennt deren Signifikanz für die zugrundeliegende ökonomische Denkweise, von der die gegenwärtige Entwicklung der digitalen Geisteswissenschaften bestimmt ist.
Die Art der Fehler und ihre erkennbare Häufigkeit sind Resultat einer Effektivitätsoptimierung durch maximale Verkürzung der für ein einzelnes Digitalisat erforderlichen Produktionszeit. Es scheint die Annahme zu bestehen, dass sich die Quote der Fehlproduktionen schon durch die schiere Menge an digitalisierten Werken relativieren ließe. Das Ziel besteht auch gar nicht darin, ein professionelles Werkzeug für die historische Forschung bereitzustellen, sondern wiederum ein digitales ‚Ding‘ anzubieten, dessen Nützlichkeit sich von der seiner analogen Vorlage dahingehend unterscheidet, dass sie von verschiedenen Nutzergruppen jeweils anders bestimmt werden kann. Nicht das einzelne Buch ist dabei von Interesse, sondern die durch sein Digitalisat eröffnete Möglichkeit, Suchanfragen mit Werbung für käufliche Exemplare und kostenpflichtige Angebote zu verknüpfen.32 Man muss davon ausgehen, dass insbesondere die Retrodigitalisierung alter Buchbestände dazu beigetragen hat, Google Books eine Spitzenposition in der internetbasierten Literaturrecherche zu verschaffen. Wie in seinen anderen Angeboten, von der Suchmaschine bis zum Kartendienst, geht es darum, zur obligatorischen Schnittstelle, zum Makler oder Kuppler zwischen Anbieter und Kunde zu werden33 – und damit zum bevorzugten Ort für die Platzierung von Werbung, der Haupteinnahmequelle des Konzerns.
Das ist für einen profitorientierten Konzern freilich weder verwunderlich noch anstößig. Woher aber rührt seitens der Bibliotheken eine derartige „auf Überstürzung angelegte Erfüllungsversessenheit“,34 dass für die möglichst rasche Digitalisierung des Gesamtbestandes bereitwillig auf bewährte Formen bibliothekarischen Qualitätsmanagements verzichtet wird? Wie auch bei den Aufnahmen von Street View handelt es sich bei den Buchdigitalisaten um Produkte, deren Nützlichkeit nur scheinbar eindeutig ist. Tatsächlich offenbart die unverhohlene Akzeptanz unbrauchbarer Retrodigitalisate seitens der Bibliotheken eine Utlilitätsdivergenz zwischen dem alten Buch und seinem digitalen Double, die nicht technischer, sondern politischer Natur ist. Es ist nicht bloße Ignoranz, die Bibliotheken mit Google paktieren lässt, sondern die seitens der Bildungspolitik geförderte Konkurrenz der Institutionen um öffentliche Gelder. Allen kulturkritischen Befürchtungen zum Trotz werden sich die Bibliotheken durch die Digitalisierung ihrer Bestände nicht abschaffen – im Gegenteil dienen die öffentlichkeitswirksamen Großprojekte vor allem der politischen Überzeugungsarbeit, um den wachsenden finanziellen Bedarf (nicht zuletzt auch für qualitativ hochwertige Digitalisierungsprojekte und die kostenintensive digitale Langzeitarchivierung) zu decken. Es entspricht dabei der Logik einer an quantifizierbare Leistung gebundenen Fördermittelvergabe, dass Profilbildung und Außendarstellung zu einer mit grimmigem Ernst und erheblichem Aufwand verfolgten Aufgabe werden und die Institutionen zu einer nicht abreißenden Folge spektakulärer Erfolgsmeldungen nötigt.35 Exzessiv verfolgt führt dieser Überbietungsprozess folgerichtig dazu, dass die Vergrößerung institutioneller Leistungsangebote nicht mehr Zweck, sondern Mittel ist, Sichtbarkeit vor Nutzbarkeit und Prestige vor Präzision geht. Überspitzt gesagt, haben weder Google Books noch die kooperierenden Bibliotheken in ihrem gemeinsamen Unternehmen ein primäres Interesse am alten Buch und seinen Lesern. Nicht das einzelne Digitalisat ist für sie von Belang, sondern die bezifferbare Masse, mit der sich finanziell vorteilhafte Spitzenstellungen im Buchhandel und im Feld der Fördermittelempfänger behaupten lassen.
Diese Strategie ist ebenso erklärlich wie sie dem vorgeblichen Plan von einer digitalen Universalbibliothek zuwiderläuft. Es steht nämlich zu befürchten, dass brauchbare Digitalisate mancher seltener Werke auf unabsehbare Weise nicht verfügbar sein werden, denn die Scans von Google Books sind ebenso wie die Straßenansichten mit verpixelten Häusern von Street View definitiv, Korrekturen oder Neuscans sind nicht vorgesehen.36 Somit bekommt das Versprechen, das Klaus Ceynowa als Stellvertreter des Generaldirektors der Bayerischen Staatsbibliothek im Jahr 2007 gab, aus geisteswissenschaftlicher Sicht eine bedauernswerte Wendung: „[U]nsere Kooperation mit Google schafft der DFG Luft. Denn, was hier bereits gemacht wird, muss die DFG nicht ein zweites Mal finanzieren.“37
Galerie 1: sichtbare Hände ↑
Galerie 2: unlesbare Seiten ↑
Galerie 3: ungeöffnete Tafeln ↑
1 Bspw. Michael Seemann. „Persönlichkeitsrecht für Jägerzäune?“ Zeit Online (6. Mai 2010). ↑
2 Jens Ihlenfeld u. Stephan Dörner. „Street-View-Fans schlagen zurück“. Handelsblatt (22. November 2010). Die Homepage der Aktion Verschollene Häuser, die nach Bekunden ihres Gründers Jens Best die Fotokampagnen organisieren sollte, war zum Zeitpunkt der Recherchen zum vorliegenden Beitrag deaktiviert. ↑
3 Vgl. Jürgen Kuri. „Google Street View sorgt weiter für Erregung“. Heise online (11. August 2010); Florian Rinke. „Immobilienmakler sauer über verpixelte Häuser“. Die Welt (21. November 2010) Andrea Möchel. „Immo-Makler gegen Google-Verschleierung“. Wirtschaftsblatt (03. Dezember 2010). ↑
4 Walter Benjamin. „Der Autor als Produzent. Ansprache im Institut zum Studium des Fascismus in Paris am 27. April 1934“. Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M.,1977, Bd. II.2, S. 683-701, S. 688. ↑
5 Vgl. Thierry Brackes. „Heute ist immer gestern“. Süddeutsche Zeitung (11. September 2013); Tilmann Baumgärtel. „Street View zeigt eine längst vergangene Welt“. Zeit Online (7. April 2014). ↑
6 Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1962 (= MEW 23), Bd. 1, S. 49-50. ↑
7 Vgl. Thomas Stäcker. „Digitalisierung buchhistorischer Quellen, Fachportale und buchhistorische Forschung jenseits der Gutenberggalaxie“. Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. Hg. v. Ursula Rautenberg. Berlin u. New York, 2010, Bd. 2, S. 711-733. ↑
8 Siehe dazu auch Thomas Stäcker. „Vom Leit- zum Leidmedium. Bibliothek und Buch zwischen auratischem Charakter und Verschwinden im digitalen Raum“. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 36.1 (2011), S. 71-79. ↑
9 Michael Giesecke. Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt a.M., 2006, S. 640-642. ↑
10 Krzysztof Pomian. „Zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem: Die Sammlung“. Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Übs. v. Gustav Roßler. Berlin, 1988, S. 13-72, hier S. 16. ↑
11 Ebd., S. 13-14. ↑
12 Vgl. ebd., S. 46-54. ↑
13 Vgl. ebd., S. 16 u. 66. ↑
14 Eine Sonderform der Faksimilierung stellen die auf Grundlage von Digitalisaten hergestellten Fälschungen dar. Siehe dazu Horst Bredekamp, Irene Brückle u. Paul Needham (Hg.). A Galileo Forgery. Unmasking the New York Sidereus Nuncius. Berlin, 2014, sowie ergänzend die Rezension von Nick Wilding in Renaissance Quarterly 67.4 (2014), S. 1337-1340. ↑
15 Vgl. Klaus Gantert. Elektronische Informationsressourcen für Historiker. Berlin u. Boston, 2011, S. 176-177. u. passim. ↑
16 Stäcker (Anm. 8), S. 74-75. ↑
17 Sowohl ECCO also auch EEBO haben allerdings inzwischen (2013 und 2015) Teile ihrer digitalen Bestände frei zugänglich gemacht. ↑
18 Siehe dazu den lesenswerten Beitrag von Clemens Alexander Wimmer. „Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Google books zu Geld werden“. B.I.T. online 4 (2012), S. 315-328. ↑
19 Siehe dazu Anne-Kathrin Marquart. „Vom Umgang mit dem kulturellen Erbe in den Zeiten des Internets. Gallica versus Gutenberg.de – Europeana versus Google Books“. Spiegelungen – Brechungen. Frankreichbilder im deutschsprachigen Kontext. Hg. v. Véronique Liard u. Marion George (Hg.). Berlin, 2011, S. 413-430. ↑
20 Vgl. Giesecke (Anm. 9), S. 642. ↑
21 Vgl. Roger Chartier. Lesewelten. Buch und Lektüre in der frühen Neuzeit. Übs. v. Brita Schleinitz u. Ruthard Stäblein. Frankfurt a.M., 1990, S. 38; Elizabeth L. Eisenstein. Die Druckerpresse. Kulturrevolutionen im frühen modernen Europa. Wien, 1997, S. 20-21; Arno Mentzel-Reuters. „Das Nebeneinander von Handschrift und Buchdruck im 15. und 16. Jahrhundert“. Buchwissenschaft in Deutschland. Hg. v. Ursula Rautenberg. Berlin u. New York, 2010, Bd. 1, S. 411-442. ↑
22 Vgl. Wolfgang Neuber. „Ökonomien des Verstehens. Markt, Buch und Erkenntnis im technischen Medienwandel der Frühen Neuzeit“. Die Verschriftlichung der Welt. Bild, Text und Zahl in der Kultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hg. v. Horst Wenzel, Wilfried Seipel u. Gotthard Wunberg. Wien, 2000, S. 181-211, hier S. 203-209. ↑
23 Wolfgang Fritz Haug. Kritik der Warenästhetik. Frankfurt a.M, 1971, S. 24. ↑
24 Aus künstlerischen oder auch aus rein unterhaltsamen Motiven heraus wurden schon vor längerer Zeit Sammlungen derartiger Pannen angelegt: Andrew Norman Wilson. ScanOps [20. Januar 2015]; Krissy Wilson. The Art of Google Books [20. Januar 2015]; Benjamin Shaykin. Google Hands [20. Januar 2015]. ↑
25 Robert Darnton. Glänzende Geschäfte. Die Verbreitung von Diderots ‚Encyclopédie‘. Oder: Wie verkauft man Wissen mit Gewinn? Berlin, 1993, S.174-190. ↑
26 Siehe dazu auch Kenneth Goldsmith. „The Artful Accidents of Google Books“. The New Yorker (4. Dezember 2013); Maximilian Probst. „Digitaler Finsterzeig. Bei Google entstand ein Foto, das es nicht geben sollte – es verrät viel über die Lebenslügen der Gegenwart“. Die Zeit Nr. 4, 16. Januar 2014, S. 46. ↑
27 Marx (Anm. 6), Bd. 1, S. 445. ↑
28 Vgl. Sigfried Giedion. Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen Geschichte. Hg. v. Henning Ritter. Frankfurt a.M., 1987, S. 70. ↑
29 Vgl. Stäcker (Anm. 7), S. 713. ↑
30 Erregt über die Unlesbarkeit von Googles Digitalisaten zeigt sich etwa auch Georg Stanitzek. „Zur Lage der Fußnote“. Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 68.1 (2014), S. 1-14, hier S. 13. ↑
31 Albrecht Dürer. Etliche underricht/ zu befestigung der Stett/ Schloß/ und flecken. Nürnberg: [Andreae], 1527. [10. März 2015]. ↑
32 Vgl. auch Klaus Gantert. Elektronische Informationsressourcen für Historiker. Berlin u. Boston, 2011, S. 182. ↑
33 „Our ultimate goal is to work with publishers and libraries to create a comprehensive, searchable, virtual card catalog of all books in all languages that helps users discover new books and publishers discover new readers.“ [08. April 2014]. ↑
34 Hans Blumenberg. Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt a.M., 1986, S. 175. ↑
35 Bspw. Johann Schloemann. „Willkommen in der größten Bibliothek der Welt“. Süddeutsche Zeitung (12. Februar 2015). ↑
36 „Due to technical constraints with our system, we’re unable to modify or overwrite scanned files. If you anticipate being able to send us a digital file or a physical copy, we recommend that you wait until you can directly submit your book to us.“ [08. April 2014] ↑
37 Dagmar Giersberg. „Von Google digitalisiert“. Goethe Institut Online (Mai 2007). ↑